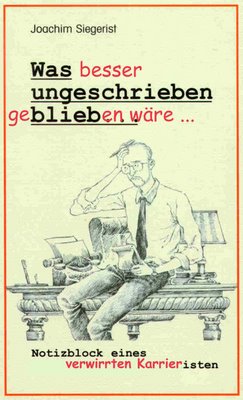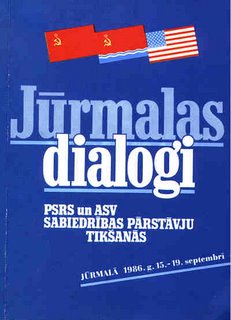Auch nach den diesjährigen Parlamentswahlen in Lettland, als zum ersten Mal eine amtierende Regierung weiterarbeiten konnte, ist das Vertrauen in die lettische Parteien nicht größer geworden.
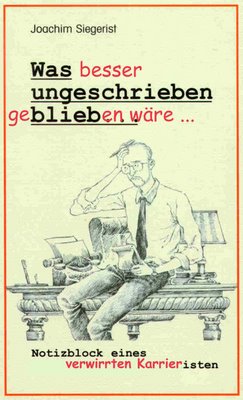
Allgemein wird die diesjährige Wahlentscheidung von politischen Beobachtern als "Wahl des kleineren Übels" bezeichnet. Allzu deutlich ist die Abhängigkeit der größeren Parteien von ihren Interessengruppen und Mäzenen im Hintergrund - nur wenige glauben daran, dass Politiker auch für das Allgemeinwohl arbeiten könnten. Aber trotz allem ist ein schlechtes Beispiel noch in Erinnerung. Wenn es darum geht, dass die Zustände in Lettland seit 1991 auch schon einmal schlimmer waren, die Demokratie auf wackeligen Beinen stand, dann wird gerne gesagt: "Ihr wollt doch nicht etwa einen wie den Siegerist wieder haben?"
Wähler durch Ausgabe von Bananen zu ködern, das war vielleicht nur das dümmste Beispiel der Wahlkampagnen des Joachim Siegerist Mitte der 90er Jahre in Lettland. Lettische Vorfahren für die eigene Karriere "ausgraben", aber kein Wort Lettisch lernen, zu Parlamentssitzungen nicht erscheinen, wegen Hetztiraden gegen verschiedene Minderheitengruppen vor Gericht verurteilt werden, aus mehreren Parteien rausfliegen, aber trotzdem frech verkünden "ich will lettischer Präsident werden" - ja, das ist alles passiert. Zu Zeiten, als Heilsverkündern aus dem Westen in Lettland noch etwas leichter geglaubt wurde.
Warum ist nie etwas aus Joachim Siegerist geworden? Bekannt war er schon immer durch seine rührseligen Bettelbriefe an meist ältere Leute, von denen er sich Spendenbereitschaft für seine Wahlkampagnen erhoffte. Für's persönliche Überleben hat das so eingenommene Geld offensichtlich immer noch gereicht. Und siehe da: es gibt wieder eine Wahlkampagne, für die Siegerist sammelt: er hofft auf die Kandidatur zur Bürgerschaftswahl in Bremen, die im Mai 2007 stattfinden wird. Doch was tun, wenn ihn in Bremen keiner kennt?
Mitglieder in kirchlichen Initiativen, Partnerschaftsvereinen oder anderen Gruppen, die im Bremer Raum Kontakt nach Lettland haben, müssen sich seit einigen Wochen wundern. Nun bekommen auch sie - ungefragt, und in immer kürzerer Frequenz - Bettelbriefe von Herrn Siegerist.
Der Spenden-ErschleicherVieles, was da geschrieben steht, kommt so wirr daher, dass es wohl schnell in die Papierkörbe wandern wird. Aber: Da wird auch mit alten und kranken Leuten geworben, die sich persönlich nicht wehren können. So wie Pastor Claus von Aderkas. Der engagierte Deutschbalte von Aderkas hatte sich jahrelang für soziale und kirchliche Projekte in Lettland eingesetzt. Momentan ist er mit nachlassenden Kräften ans Bett gefesselt, und wird sich kaum vorstellen können, wie unverschämt aus seinem ideelen Erbe Kapital geschlagen wird. Siegerist verschickte nun Fotos, auf denen von Aderkas bei einem Besuch in einem Altenheim zu sehen ist, geschickt versehen mit einem Begleittext, der den Anschein erweckt, nur Siegerist sei in der Lage, die sozialen Projekte, die von Aderkas angefangen hatte, weiterzuführen. Natürlich ist das Ganze immer versehen mit Zahlscheinen, vorgedruckten Spendenanweisungen und Ähnlichem. Und vor allem: Pastor von Aderkas' Bekannte und Freunde bekommen nun - ungefragt - alle diese Post des Herrn S.
Warum? Absender ist die "Aktion Reiskorn" in Hamburg. Angefüllt sind diese Briefe mit merkwürdigen Texten, von "die Miezekatze der Buchhalterin Rosa" bis zu "Onkel Hermann will Foxtrott tanzen". "Ganz nebenbei" mit verkauft werden Behauptungen, Soldaten hätten im 2.Weltkrieg nicht für Hitler oder die NSDAP gekämpft, sondern vor allem gegen Stalin. Gegen Stalin? Hatte nicht Nazi-Deutschland mit nahezu allen Nachbarn einen Krieg angezettelt, Herr Siegerist?
Nicht diskutieren -aber alte Menschen ausnehmen!Ja, auch ein Herr Siegerist wird eben älter. Da wird nicht mehr diskutiert - aber fleißig Geld eingesammelt schon! Das Prinzip ist einfach: es ist Weihnachszeit, und wer seriös aussehenden Briefen hübsch ausgefüllt Zahlkarten, immer schön mit dem eigenen Bankonto als Empfängeradresse beilegt, der kann vielleicht auf eine gewissen "Erfolgsquote" hoffen. Vor allem bei gutgläubigen alten Menschen. Kürzlich wurde gar ein komplettes Buch mitgeschickt, sozusagen "gestammelte Werke", die sonst niemand veröffentlichen wollte. Da hofft unser Herr Joachim wohl auf die Ordnungsliebe der Deutschen, die auf erhaltene Waren auch immer die Rechnung zahlen. Und, warum das alles? Warum das Risiko eines völligen Ruins des eigenen Rufs (der eh schon lädiert genug ist)?
Nun, in Bremen ist eben Wahlkampf. Und sowas kostet Geld. Noch hofft Herr Joachim, dass er mit einer frisch gegründeten Partei antreten kann, um Bremen 2007 zu retten.
Radio Bremen berichtete am 9.10.2006 darüber. Hart gearbeitet hat Siegerist auch dafür, um seinen bisherigen Ruf als Rechtsextremist so zu bearbeiten, dass sich NPD (
7.9.2005, NPD Sachsen) von ihm bereits distanzierte. Und die
"Deutschen Konservativen" sagten schon mal über Herrn Joachim:
"Stets an vorderster Front, wenn es darum geht, große Töne zu spucken". Aber auch in Lettland hatten gelegentlich groß publizierte Spenden an die jüdische Gemeinde in Riga die Rechtsaußen-Gesinnung nicht wirklich verdecken können - eine Einreise nach Israel wurde ihm untersagt (
Hagalil 12.11.1998). Und dafür, dass er in der
"Jungen Freiheit" gefeiert wird, schämt sich Siegerist natürlich ebenfalls nicht.
Er hätte es besser gelassen - nun ist es zu spät. Peinlich, peinlich, Herr Siegerist. Machen Sie nur so weiter: wehleidiges Gebettel, oder öffentliches Nachdenken über "alte Sünden". Der Kreis Ihrer erhofften Unterstützer ist längst nicht so groß wie Sie vielleicht glauben.
Wir erweisen Ihnen aber gern noch einmal die letzte Ehre - und erklären hiermit diesen aufdringlichen Mist für eine Schande: für Lettland schon lange, und nun auch für Bremen! Wer das nicht merkt, ist selber Schuld!
 Und schon ist in Lettland selbst eine Debatte ausbrochen, um die vorgezeigten Themen und Motive denn dem gewünschten Außenbild von "Maija & Janis Musterlette" entspricht. "Es sollten doch die Dinge gezeigt werden, auf die wir selbst stolz sind," so Erna Bērziņa aus dem Bezirk Cēsis, befragt für die "Latvijas Avize" (Ausgabe 16.2.2007), und denkt dabei ganz praktisch: "das Freilichtmuseum, das Sängerfest und das Freiheitsdenkmal sollten gezeigt werden, damit die Auländer auch wissen, dass sie da nicht dranpissen sollen!"
Und schon ist in Lettland selbst eine Debatte ausbrochen, um die vorgezeigten Themen und Motive denn dem gewünschten Außenbild von "Maija & Janis Musterlette" entspricht. "Es sollten doch die Dinge gezeigt werden, auf die wir selbst stolz sind," so Erna Bērziņa aus dem Bezirk Cēsis, befragt für die "Latvijas Avize" (Ausgabe 16.2.2007), und denkt dabei ganz praktisch: "das Freilichtmuseum, das Sängerfest und das Freiheitsdenkmal sollten gezeigt werden, damit die Auländer auch wissen, dass sie da nicht dranpissen sollen!"